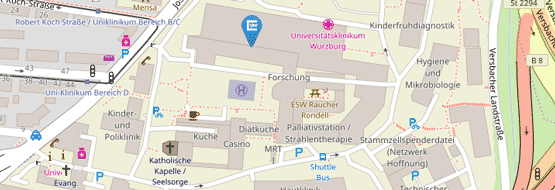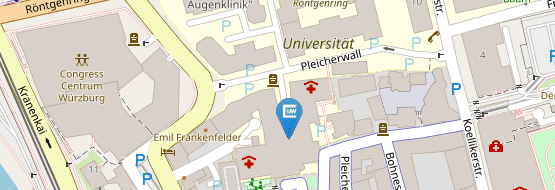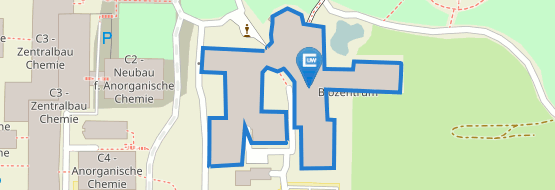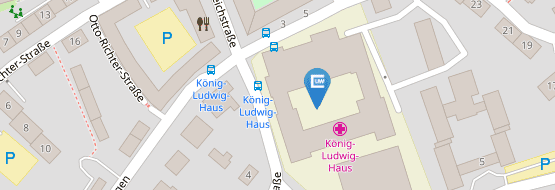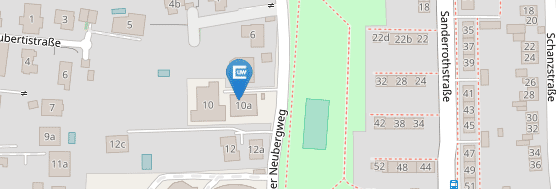Die Bibel als Kulturgut erschließen
15.04.2025Veronika Bachmann ist seit 1. April 2025 Professorin für Biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaften an der Uni Würzburg. Neben Schriften aus der Bibel erforscht sie auch außerbiblische Texte.

Es ist das meistübersetzte Buch der Weltgeschichte: Die Bibel. Über ihre Inhalte grübeln Menschen seit Jahrhunderten. Auch heute können ihre Texte unterschiedlich interpretiert werden: Während gewisse Gruppierungen die Bibel wörtlich nehmen, versuchen andere zum Beispiel die tiefere Symbolik hinter den Texten zu ergründen. Wieder andere möchten heute gar nichts mehr mit der Bibel zu tun haben, da sie ihnen insgesamt als zu veraltet vorkommt.
Den wissenschaftlichen Zugang wählen Theologinnen und Theologen. Zu ihnen gehört Veronika Bachmann. Sie ist seit 1. April 2025 neue Professorin für Biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).
Bachmann sieht in der differenzierten Auseinandersetzung mit Bibeltexten eine wichtige Kompetenz: „In der Bibel steckt vielstimmige Literatur, verfasst von Menschen, die viel über Gott und die Welt nachgedacht haben. Sie ist ein Kulturgut, das es vor allem gegen politische und religiöse Instrumentalisierungen zu schützen gilt.“ In ihrer Lehre wappne sie die Studierenden, die Texte wissenschaftlich basiert einzuordnen. Dazu gehöre es, die unterschiedlichen Schriften als Literatur ernst zu nehmen, ihre Entstehungskontexte zu kennen und die Vorstellungen und Visionen, die sie zum Thema machen, auf diesem Hintergrund zu verstehen.
Schriften außerhalb des Bibel-Kanons
Ein Forschungsschwerpunkt der Theologin liegt auf Texten, die nicht in den Bibelkanon aufgenommen worden sind und aus der hellenistisch-römischen Zeit stammen. Dies umfasst die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament – also ungefähr 350 vor Christus bis 50 nach Christus.
Von großer Bedeutung sind die Schriftrollen vom Toten Meer, die in den 1940ern und 1950ern in Höhlen nahe Khirbet Qumran im Westjordanland gefunden worden sind. Darunter finden sich die ältesten bis heute erhaltenen Fragmente biblischer Texte, aber auch Stücke von Texten, die in Vergessenheit geraten sind, weil sie keinen Eingang in die Bibel gefunden haben. „Erst die Beschäftigung mit diesen Texten lässt uns beispielsweise besser nachvollziehen, warum Menschen in Jesus von Nazareth den erwarteten Messias, also eine königliche Erlösergestalt sehen konnten, obwohl er politisch keine glorreiche Karriere hingelegt hat, sondern am Kreuz hingerichtet worden ist“, so Bachmann.
Ihre Studierenden sollen sich nicht zuletzt mit Fragen rund um das Materielle beschäftigen. „Zu wissen, wie damals geschrieben wurde, ist wesentlich, um fundierte Thesen aufzustellen“, meint sie. Anders als heute habe man zum Beispiel nicht zwingend Worttrenner verwendet und keine Satzzeichen gesetzt. Das alles mache das Interpretieren der alten Texte anspruchsvoll, aber auch spannend.
Das Buch Ester: Ein Text mit vielen Versionen
Die neue Professorin beschäftigt sich auch mit dem Alten Testament. Unter anderem mit dem Buch Ester; ein Werk, von dem es eine hebräische Fassung, zwei altgriechische und zwei lateinische Fassungen gibt. Sie interessiert sich vor allem für die Unterschiede: „In der hebräischen Version kommt Gott nicht vor, während er in den griechischen und lateinischen Erzählversionen genannt wird. Die Unterschiede darzulegen und zu erwägen, worin diese begründet sein könnten, ist das Spannende an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung“, so Bachmann.
Das Buch Ester spielt im alten Persien. Es erzählt vom Judäer Mordechai, der sich weigert, sich vor Haman niederzuwerfen – einem Beamten, den der König in eine mächtige Stellung befördert hat. Als Konsequenz plant Haman die Ermordung aller Judäerinnen und Judäer im Königreich. Das Buch erzählt weiter, wie diese Gefahr abgewendet werden kann – unter anderem durch das Handeln Esters, Mordechais Cousine, die der König zu seiner Frau erkoren hat.
Den Formen antiker Judenfeindlichkeit nachgehen
„Das Ester-Buch verknüpft das Motiv der kollektiven Bedrohung mit dem Motiv einer kollektiven Verleumdung – vor dem König erzählt Haman von einem Volk, das nicht den königlichen Gesetzen folge und daher auszurotten sei. Diese Kombination von Verleumdung und Bedrohung hat Jüdinnen und Juden im Laufe der Geschichte unseligerweise mehrfach eingeholt“, merkt die Professorin an. Das Ester-Buch halte zuletzt dazu an, sich mit Judenfeindlichkeit und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen.
Um Formen antiker Judenfeindlichkeit nachzugehen, liest sie auch Schriften aus benachbarten Kulturen. „Schon in einem Text des altägyptischen Priesters Manetho finden sich despektierliche Pauschalisierungen“, so Bachmann. Es sei wichtig, solche Belege genau zu untersuchen und die Wirkmacht des Schreibers zu prüfen, damit keine verkürzten Schlussfolgerungen gezogen werden. Genaues, detailliertes Lesen sei hier gefordert.
Von der Schweiz nach Würzburg
Nach Würzburg lockte die gebürtige Schweizerin das Profil der Professur und der Fakultät: „Es gibt nur weniger bibelwissenschaftliche Stellen mit gesamtbiblischem Fokus. An der Würzburger Fakultät ist mir aufgefallen, dass sie ihre Studiengänge sehr gut an die Bedürfnisse der Studierenden anpasst und ihnen dadurch eine zeitgemäße theologische Ausbildung bietet.“
Zur Person
Veronika Bachmann ist 1974 in Luzern geboren worden. An den Universitäten in Freiburg (Schweiz) und Tübingen studierte sie Theologie, Altorientalistik und Philosophie. Im Jahr 2003 legte sie ihr Lizenziat in Freiburg ab.
Sieben Jahre später wurde sie an der Universität Zürich promoviert. 2022 folgte die Habilitation in Tübingen. Bis Ende März 2025 leitete Bachmann den Fachbereich Theologie und Religion an der Paulus Akademie in Zürich.
Seit 1. April 2025 hat sie die Professur für Biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaften am Institut für Biblische Theologie an der JMU inne.
Kontakt
Prof. Dr. Veronika Bachmann, Professur für Biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaften, T +49 931 31-87585, veronika.bachmann@uni-wuerzburg.de