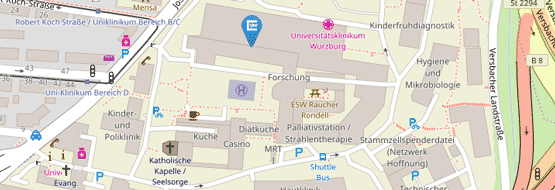Aktive Galaxienzentren im Blick
Aktive Galaxienkerne gehören zu den hellsten Lichtquellen im Universum. Hier vermuten Astrophysiker in aller Regel Schwarze Löcher. Welche physikalischen Prozesse laufen dort ab? Das erforscht Matthias Kadler, der seit März 2011 eine Professur für Astrophysik an der Universität Würzburg inne hat.
„Meine Arbeitsgruppe befasst sich vorwiegend mit einer Untergruppe von aktiven Galaxienkernen, bei denen die Radio- und Gammastrahlung besonders intensiv ist“, so Matthias Kadler. Gewaltige dynamische Prozesse spielen sich dort ab: In unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs wird Materie fast mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Einflussbereich des Lochs hinausgeschleudert. So entstehen riesige Plasmaströme, so genannte Jets, die sich von der Erde aus beobachten und abbilden lassen.
„Wir können kleinste Strukturen sichtbar machen und einzelne Jet-Komponenten über Wochen bis Jahre in Echtzeit verfolgen“, sagt der neue Professor. Mit Hilfe der so genannten VLBI-Methode (Very-Long-Baseline Interferometry) schaltet er Radioteleskope auf unterschiedlichen Kontinenten zusammen, so dass sich „eine einzigartige Winkelauflösung im Millibogensekunden-Bereich ergibt, tausendmal besser als bei optischen Großteleskopen“. So lassen sich auch die starken Helligkeitsausbrüche aktiver Galaxienkerne ergründen, zu denen es immer wieder kommt – im Bereich des sichtbaren Lichts, aber auch bei der Röntgen- und Gammastrahlung.
Forschungsinteressen des Astrophysikers
Woraus bestehen Jets, welche Prozesse führen zu ihrer Bildung? Wie entsteht die immense Leuchtkraft der Galaxienkerne über das gesamte elektromagnetische Spektrum hinweg? Solche Fragen will Kadler beantworten. Dabei kooperiert er mit weiteren Arbeitsgruppen am Würzburger Lehrstuhl für Astronomie, aber auch mit externen Partnern wie dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und dem NASA Goddard Space Flight Center in den USA.
Kadlers jüngster Forschungserfolg wurde erst vor einigen Tagen publik: Mit einem internationalen Team gelang ihm eine spektakuläre Nahaufnahme von der Umgebung des Schwarzen Lochs in der Galaxie Centaurus A. Das Bild zeigt in bislang nicht gekannter Auflösung die Entstehungsregion der Jets.
Großteleskope im Meer, auf der Erde, im Weltraum
Für ihre Forschungen nutzt die Gruppe von Professor Kadler die Daten verschiedenster Großteleskope. Im Weltraum stationierte Röntgen- und Gammastrahlungsdetektoren gehören ebenso dazu wie fußballplatzgroße Radioteleskope auf der Erde und Neutrinoteleskope, die ihre Arbeit unterseeisch erledigen.
Die wichtigsten Instrumente, auf die Kadlers Arbeitsgruppe zurückgreift: das 100-Meter-Radioteleskop Effelsberg in der Eifel, das vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie (Bonn) betrieben wird. Die zehn zusammengeschalteten Radioteleskope des Very-Long-Baseline-Array in Nordamerika sowie ein vergleichbares Netzwerk auf der Südhalbkugel der Erde. Außerdem die Weltraum-Röntgen-Observatorien XMM-Newton und Integral der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, das Weltraum-Gammastrahlungsobservatorium Fermi der NASA und das Neutrinoteleskop Antares im Mittelmeer.
„An der Vorbereitung von astronomischen Großteleskopen der nächsten Generation sind wir ebenfalls beteiligt, zum Beispiel an der deutschen eRosita-Röntgen-Mission, dem einen-Kubikkilometer großen Neutrinoteleskop KM3NeT und an der Gammastrahlungs-Mission Grips“, so Kadler.
Werdegang von Matthias Kadler
Matthias Kadler, 1975 in Brake geboren, hat Physik an den Universitäten Hamburg und Bonn studiert. Von 2001 bis 2005 fertigte er am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn seine Diplom- und seine Doktorarbeit an. 2005 folgte die Promotion in Astronomie an der Universität Bonn. Danach, von 2005 bis 2008, arbeitete Kadler in den USA am Goddard Space Flight Center der NASA. Von dort wechselte er an die Universität Erlangen-Nürnberg und im März 2011 schließlich an die Universität Würzburg.
Kontakt
Prof. Dr. Matthias Kadler, Institut für Theoretische Physik und Astrophysik,
T (0931) 31-85138,
![]() matthias.kadler(at)astro.uni-wuerzburg.de
matthias.kadler(at)astro.uni-wuerzburg.de