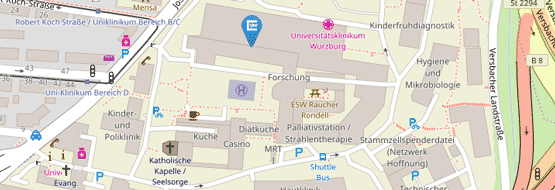Nobelpreis in Physik 2006
Der Nobelpreis in Physik geht zu gleichen Teilen an die beiden US-Amerikaner John Mather (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt) und George Smoot (University of California, Berkeley).
The Nobel Prize in Physics 2006
"for their discovery of the blackbody form and anisotropy of the cosmic microwave background radiation"
(Information for the Public / Advanced Information)
Mit der diesjährigen Verleihung des Nobelpreises für Physik an die beiden
US Amerikaner John Mather (NASA Goddard Space Flight Center) und George Smoot (UC Berkeley) werden die "Macher" von COBE gewürdigt, einer NASA Satellitenmission (1989-1993) zur Messung der Mikrowellenstrahlung im Universum. Die Messungen bestätigten theoretische Vorhersagen der Urknalltheorie, nach der sich das Universum aus einem sehr dichten und heißen Zustand entwickelt hat und sich Sterne und Galaxien aus anfänglich winzigen Störungen zusammmenballten ("Wrinkles on the face of God" - G. Smoot).
Die Nachfolgemission WMAP hat inzwischen weitere spannende Details des
frühen Universums aufgedeckt. Dazu gehört auch der Befund, dass die Materie im Universum größtenteils aus Teilchen besteht, die sehr schwach wechselwirken und daher bislang als "dunkle Materie" nur aufgrund ihrer Schwerkraft eindeutig nachgewiesen werden konnten. Erst vor kurzem ergab eine neue Analyse von Daten des Gammastrahlenobservatoriums EGRET, die an der Universität Würzburg von Karl Mannheim und Dominik Elsässer durchgeführt wurde, einen ersten deutlichen Hinweis auf die Natur der Dunkelmaterie (Bericht in DER SPIEGEL 23/2005). Demnach besteht die Dunkelmaterie, die für das Zusammenballen der von COBE gesehenen winzigen Dichteschwankungen im Urknall verantwortlich ist, aus Elementarteilchen mit etwa der doppelten Masse des Goldatoms. Die Europäer warten noch auf ihr Flaggschiff PLANCK, einer ESA Mission, die 2007 starten und ein noch schärferes Bild der Urknalls liefern soll. Wie Jens Niemeyer von der Universität Würzburg vermutet, könnten diese Daten vielleicht auch Hinweise auf die Struktur von Raum und Zeit bei sehr kurzen Abständen mit sich bringen.
Die kleinste denkbare Länge ist dabei die sogenannte Planck-Länge, die nach dem Physiker Max Planck benannt ist. Die Verbindung der Quantenwelt des Mikrokosmos mit dem durch die Gravitation beherrschten Makrokosmos der Astronomie stellt eine der großen Herausforderungen für die physikalische Grundlagenforschung dar, an der auch die zahlreichen Kollegiaten des Würzburger Graduiertenkollegs "Theoretische Astrophysik und Elementarteilchenphysik" intensiv mitarbeiten.