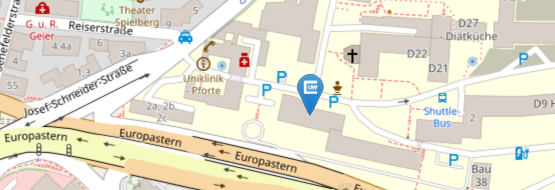Lehrkonzepte & Lehrmethoden
In unseren curricularen und extracurricularen Kursen erfolgt ein strukturierter und supervidierter Unterricht unter Berücksichtigung evidenzbasierter Lehrmethoden und Lehrkonzepten.
Zum Erlernen praktischer Fertigkeiten ist es insbesondere wichtig, ein standardisiertes von Dozierenden angeleitetes Training zu durchlaufen. Unsere Pflichtkurse verfügen daher über ein einheitliches didaktisches Konzept und werden von Dozierenden verschiedener Fachdisziplinen geleitet.
Didaktische Konzepte
Der Unterricht in unserer Lehrklinik berücksichtigt das „SPICES“-Modell nach R.M. Harden, einem Akronym aus sechs Lehrstrategien: S tudent-based, P roblem-based, I ntegrated, C ommunity-based, E lectives, S ystematic (Harden RM. Curriculum planning and development. In: Dent JA, Hareden RM (Hrsg). A Practial Guide for Medical Teachers. China: Elsevier Limited; 2014.)
S – „Student-based learning“- studierendenzentriertes Lernen
Im Gegensatz zur klassischen „teacher-centered“-Veranstaltung, in der der Dozierende die Lernerfolge steuert, liegt die Verantwortung bei vielen Lehrklinik-Kursen auf den Studierenden. Jeder Einzelne kann durch Eigeninitiative die individuellen Lernziele festlegen und vorantreiben, wobei die übergeordneten Lernziele vom Dozierenden vorgegeben werden.
P – „problem-based learning“- problembasiertes Lernen
In einigen der Lehrklinik-Kursen werden gezielt Problemlösestrategien trainiert, um den Transfer von theoretischem Wissen zu einem expliziten Krankheitsbild zu erleichtern.
Beispielsweise werden in interprofessionellen Kursen die Teilnehmer aus verschiedenen Gesundheitsberufen vor ein klinisches Problem gestellt (u.a. Patient mit Atemnot) und müssen in Teams eine geeignete Vorgehensweise kooperativ erarbeiten. Dabei werden sie von Dozierende betreut und unterstützt.
I – „Integrated Teaching“ -Integration verschiedener Disziplinen in Lehrveranstaltungen
Die verschiedenen Arten der Integration nach Harden dienen vor allem der Internalisierung von bereits Gelerntem, damit dies später in der klinischen Praxis vereinfacht abgerufen werden kann. Harden unterteilt die Integration in einen vertikalen und einen horizontalen Teil.
Bei der vertikalen Integration handelt es sich um die inhaltliche Verknüpfung von Kursen verschiedener Semester. So wird zuvor gelerntes nochmal wiederholt und vertieft. Beispielsweise wird in der Lehrklinik im 5. Semester ein Untersuchungskurs angeboten, der die Untersuchungstechniken lehrt, die im klinischen Praktikum Innere Medizin im 6. Semester nochmal wiederholt werden.
Bei der horizontalen Integration hingegen handelt es sich um die Verknüpfung verschiedener Fachbereiche. In die Integration ist nach Harden auch interprofessionelles Training eingeschlossen.
C – „community-based teaching“ – Gemeindeorientierung der Lehre
Um eine ganzheitliche und allumfassende Ausbildung der Medizinstudierenden zu ermöglichen und deren Wahrnehmung gegenüber dem Patienten als Ganzem sowie anderen medizinischen Gesundheitsprofessionen zu verbessern, sollen „Community-based-Teaching“ Konzepte auch im Studium involviert werden. Ein erster Ansatz hierfür in der Lehrklinik sind interprofessionelle Kurse (Link), Rollenspiele und die Einbeziehung des Feedbacks von Simulationspatienten.
E – „elective classes“ - Wahlunterricht
Die Lehrklinik bietet den Studierenden die Möglichkeit sich durch Freiwillige Kurse weiterzubilden oder bereits erlernte Fertigkeiten zu präzisieren und vertiefen. Die Studierenden können dabei aus einer Vielzahl von interessanten Kursen selbst wählen, ob und wie viele dieser Veranstaltungen sie besuchen wollen.
S – „systematic teaching“ – systematische Unterrichtsplanung
Zum Erlernen praktischer Fertigkeiten ist es insbesondere wichtig, ein standardisiertes, von einem Dozierenden angeleitetes Training zu durchlaufen. Unsere Pflichtkurse verfügen deswegen über ein einheitliches didaktisches Konzept und werden von Dozierenden aus verschiedenen Fachdisziplinen geleitet. Im Rahmen der OSCE-Prüfungen werden die praktischen Fertigkeiten dann als Kursleistung geprüft.
Blended Learning bezeichnet die Verknüpfung von Präsenzlehre und virtuellen Lernmöglichkeiten. Dabei kommen sowohl die Vorteile des Audiovisuellen Lernens oder E-Learnings als auch von Präsenz- und praktischen Veranstaltungen zum Tragen. Das zuvor durch das Skript und Lehrvideos Gelernte kann in den zahlreichen praktischen Kursen der Lehrklinik diskutiert und vertieft werden. Das Lernen wird somit effizient gestaltet, in dem der Präsenzunterricht an das vorher Erlernte anknüpft und dieses vertieft.
Lehrmethoden
Das sogenannte Peer-Teaching bezeichnet eine Lehrmethode, bei dem fachlich und didaktisch ausgebildete studentische Tutoren ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen unterrichten. Sie betreuen die Studierenden beim Üben an Simulatoren und Phantomen. In mehreren Studien hat sich Peer Teaching als gleichwertig zum ärztlich instruierten Training erwiesen. Es ermöglicht „Lernen auf Augenhöhe“.
Dieser Ansatz bietet für beide Seiten viele Vorteile. Die Tutoren wissen um die anfänglichen Schwierigkeiten und auf welchem Niveau sie ihre lernenden Kommilitoninnen und Kommilitonen abholen. Außerdem besteht aufgrund der konstruktiven Lernatmosphäre bei den Lernenden eine niedrige Hemmschwelle für Rückfragen. Die Tutoren beantworten und erklären verständlich durch die Verwendung gleicher Sprachcodes. Die Kurse finden in Kleingruppen statt, sodass auf individuelle Feedback stattfinden kann.
Die Tutoren ihrerseits profitieren ebenfalls von dieser Tätigkeit. Sie sammeln erste Erfahrungen als Dozierende in der Lehre, können Kontakte zu Dozierenden aus der Klinik knüpfen, verbessern ihre praktischen Kenntnisse und erwerben Routine für die Umsetzung in der Praxis. Außerdem genießen die Tutoren eine umfangreiche fachliche wie auch didaktische Ausbildung, die durch Hospitationen, Schulungen sowie praktische Übungen bereitet wird.
Da Wissen am besten im Kontext bzw. mit klinischen Bezügen gelingt, wird in der Lehrklinik in möglichst realitätsgetreuen Situationen gelehrt und gelernt.
So dient beispielsweise ein komplett eingerichteter OP-Saal mit Schleuse und Waschraum zur Einweisung in die Verhaltensweisen im OP, wie das Anziehen steriler OP-Kleidung, chirurgische Händedesinfektion, steriles Arbeiten und Bewegen im sterilen Raum.
Auch das Training mit Schauspiel- und Simulationspersonen, teilweise mit Videoaufzeichnung und –analyse, vermittelt durch das Lernen an klinischen Fällen, Kompetenzen in der Arzt-Patienten-Kommunikation, und im Notfallmanagement.
Diese Methode dient dem Vermitteln praktischer Fertigkeiten in vier Schritten.
In der ersten Phase dieser Methode demonstriert der Dozierende die zu lernende Fertigkeit unkommentiert und in gewohnter Schnelligkeit.
In der zweiten Phase wiederholt er diese Fertigkeit langsam und erklärt jeden einzelnen Schritt genau.
In der dritten Phase lässt der Dozierende sich jeden einzelnen Schritt von Studenten erklären und führt die Schritte nach den Anweisungen der Studierenden aus.
Im letzten Schritt führen die Studierenden die Fertigkeit unter Supervision selbst durch.
Diese Methode verbessert die Lernerfolge im Hinblick auf Professionalität und der Arzt-Patienten-Kommunikation. (Effects of Peyton’s Four-Step Approach on Objective Performance Measures in Technical Skills Training: A Controlled Trial, Krautter et al., 2011)
Die Kurse der Lehrklinik sind stark orientiert an dieser Methode, sodass die Studierende zunächst am Vorbild der Dozierenden lernen können und durch Feedback von Dozierenden, TutorenInnen und KommilitonenInnen ihre praktischen Fertigkeiten erweitern.
Durch Simulatoren und Phantome können komplexe ärztliche Tätigkeiten vor dem ersten echten Patientenkontakt unter standardisierten Bedingungen gelehrt, erlernt und vertieft werden. Dies beinhaltet sowohl die Untersuchungstechniken und die hygienischen Regeln als auch den Umgang und die Kommunikation mit dem Patienten. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad individuell adaptierbar. Wiederholungen sind beliebig oft möglich und im geschützten Raum können Studierende ohne Bedenken lernen.
Unterschieden wird heutzutage zwischen drei Arten von Simulatoren (Stein et al. (2018) Wie im wahren Leben: Simulation und Realitätsnähe. In: St.Pierre M., Breuer G. (eds) Simulation in der Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg):
Unter den sogenannten „low-fidelity“-Simulatoren versteht man die Simulation mit einfachen Puppen, durch die v.a. prozedurale Fertigkeiten gelernt und geübt werden können. Beispielsweise werden sie zum Erlernen der Blutentnahme oder zum Legen von Kathetern etc. eingesetzt.
„Medium-fidelity“-Simulation bezeichnet die Simulation mit funktionalen Puppen, die z.B. beim Reanimationstraining zum Einsatz kommen.
Zur „high-fidelity“-Simulation gehört das Training mit programmierbaren Puppen, sowie das Training mit standardisierten Patienten (Schauspielpersonen). Programmierbare Puppen haben dabei den Vorteil, dass physiologische Parameter, wie z.B. Atmung, Blutdruck oder bestimmte Abhörphänomene eingestellt werden können und die Puppen bei der Behandlung durch Studierende auf deren Tätigkeiten reagieren.
Durch Schauspielpersonen können vor allem „non-technical skills“, wie z. B. die Kommunikation und Interaktion mit Patienten verbessert werden. Außerdem wird die Übertragung von theoretischem Wissen auf eine „reale“ Situation erprobt, indem z.B. ein Anamnesegespräch mit Schauspiel geführt werden soll. Um die Rolle der Schauspielpersonen, die durch (Laien-)Schauspieler verkörpert wird, möglichst authentisch wirken zu lassen, bekommen die Schauspielpersonen genaue Vorgaben über medizinische und nicht-medizinische Umstände ihrer Rolle.
Weitere Informationen über das Schauspielpatienten-Programm finden Sie hier.
Um den Studierenden die Rolle des Patienten näherzubringen und deren Empathie und soziale Kompetenz zu fördern, spielen bzw. erleben die Studierenden in einigen Kursen die Situation als Arzt sowie auch als Patient.
Reale Situationen werden spielerisch simuliert, während Teilnehmende aus klar definierten Rollen heraus agieren. Nach dem Rollenspiel wird die Situation von den beobachtenden Studierende und dem Dozierende beurteilt, sodass am Ende die optimale Herangehensweise gemeinsam erarbeitet werden
Die Studierenden lernen so nachzuempfinden, wie sich der Patient in bestimmten Situationen fühlt und können in der Rolle des Arztes üben, dem Patienten ein möglichst angenehmes Umfeld zu schaffen.